- Start
- Susanne Krahe
- Bücher
- Organspende- Ein Akt der Nächstenliebe?
- Der Geschmack von Blau
- Markus. Der Zweifler
- Aug' um Auge. Zahn um Zahn
- Der defekte Messias
- Rahels Rache
- Adoptiert: Das fremde Organ
- Ermorderte Kinder
- Die Letzten werden die Ersten sein
- Blinden-Blick
- Auf Maulbeerbäumen sitzt es sich nicht sehr bequem
- Das riskierte Ich. Paulus aus Tarsus
- Artikel & Beiträge
- CDs
- Zum Reinhören
- Hörspiele
- Radiotermine
- Vortragstermine
- Vortragsthemen
- Bestellungen
- Kontakt
Blinden- Blick
Reisen in das beschädigte Leben
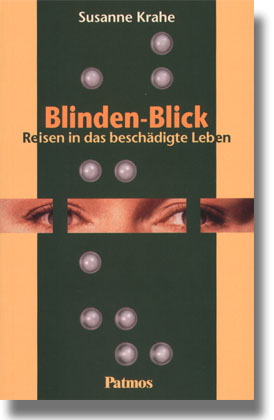
200 Seiten. Broschiert. Patmos Verlag Düsseldorf, 1996. ISBN 3-491-72354-X
Die Geschichten dieses Buches führen ihre Leser in die Tabuzonen der Gesellschaft: auf Intensivstationen, in Krankenzimmer, Pflegeheime und Operationssäle. Sie laden sie ein, dorthin zu schauen, wohin man gewöhnlich nicht schaut: in die allmählich leerer werdenden Hinterstübchen einer Alzheimer-Patientin oder auf den Stumpf eines beinamputierten Mädchens. Und sie führen Modelle heilsamer und unheiliger Beziehungen zwischen Behinderten und Nichtbehinderten vor. Die Thematik von Pflegegesetz und Hilfsdiensten, von Organtransplantation, Gerätemedizin und Euthanasie macht die vorliegenden Texte zu originellen Beiträgen der aktuellen medizinethischen Diskussion.
Rezensionen
Verkrüppelte Helden
Susanne Krahe beschreibt den Alltag Behinderter
Viele Experten und Behinderte selbst sprechen heute von einer neuen Behindertenfeindlichkeit. Das mag zunächst überraschen, wenn man sich das perfekt
gemanagte System an Hilfeleistungen für Menschen mit Behinderungen anschaut. Im Zeichen von Integration, Rehabilitation und Therapie verwaltet ein ganzer
Behördenapparat die »Anspruchsberechtigungen« von Behinderten auf medizinische Behandlung, pädagogische Förderung und
apparative Versorgung.
Aber im Beschwören solcher Zauberworte wie »Integration« und »Normalisierung« ist vielfach etwas ganz anderes angestrebt.
Hinter der Perfektionierung medizinischer Eingriffe und berufsmäßiger Hilfsangebote durch die Gesellschaft steht oft der geheime Wunsch, die
Behinderung »wegzutherapieren«, nach der optimistischen Vision vom vollständig rehabilitierbaren, reparaturfähigen Menschen.
Susanne Krahes »Blindenblick« deckt solche Verdrängungsprozesse schonungslos auf. Die Autorin, die nach einer plötzlichen Erblindung
selbst mit einer Behinderung fertig werden muß, führt den Leser in die Tabuzonen einer Gesellschaft, die ihre perfekte »Luxusmedizin« und
ihr durchorganisiertes Versorgungssystem »gern benutzt, um existentielle Auseinandersetzungen zu meiden«. In der aktuellen ethischen Diskussion um
Gerätemedizin, Hirntod, Organtransplantation und Pflegedienst bleibt, so Krahe, die Perspektive der unmittelbar Betroffenen auf der Strecke.
Der »Blindenblick« liefert ein Korrektiv zu solchen »toten Winkeln« und »blinden Flecken«, er schaut auf den Lebensalltag
behinderter Menschen, auf die Auswirkungen körperlicher und geistiger Schädigungen und konfrontiert den Leser mit jenen verstörenden
»Details«, die eine »Beschädigung« zur »persönlichen Katastrophe« machen.
Susanne Krahe leuchtet Schauplätze wie Intensivstationen, Operationssäle und Pflegeheime literarisch aus, bewußt abseits der wissenschaftlichen
Analysen. Der literarische Blindenblick entgeht so der Gefahr lamentierender Pathetik und wird offen für die Grenzbereiche beschädigten Lebens, vor allem
auch für das Absurde und Groteske solchen Lebens, dem mit distanzierter Wissenschaftlichkeit oder weinerlicher Betroffenheitsrhetorik nicht beizukommen ist.
Der Leser sieht sich in eine ungewohnte »Innenperspektive« versetzt: Da ist der »Schrumpfkopf« einer Alzheimer-Patientin, der den
»Zerstörungsprozeß« protokolliert, in dem »Vergessen« die Wirklichkeit unaufhaltsam zudeckt. Da ist der mongoloide Embryo,
»Ungestalt«, der »mißlungene Entwurf«, der in dem »verletzlichen Schoß« zum »Alptraum« wird.
Das literarische Ich des »Blindenblicks« inszeniert sich bewußt gegen die üblichen Klischees. Krahes »Helden« sind keine
»Musterkrüppel«, keine »Vorführmodelle« und erst recht nicht »fügige« Leidende. Sie
»gewöhnen« sich nicht und finden sich nicht ab mit ihrer »Beschädigung«. Mehr noch, sie
»empören« sich, so wie jeder gelähmte Bettlägerige, der sich nicht »fügen« will in das »unwürdige«
und »beschämende« Ausgeliefertsein an defekte Körperfunktionen.
Entsprechend präsentiert auch die vor einem sehr persönlichen Hintergrund geschriebene Szenenfolge um eine Blinde keine »Vorzeigeblinde«.
Für das gängige Blindheitsstereotyp, das Blinde zu »innerlich Sehenden« verklärt, ist im »Blindenblick« kein Platz.
Vorherrschend ist das Bild des Verlusts, des Mangels, der durch die vermeintlichen Vorzüge eines die alltägliche Lebenswelt transzendierenden Sehens
nicht aufgewogen wird.
Behinderte, so Krahe, »sind keine Engel, bloß weil sie leiden«, und sie sind auch nicht reifer und sensibler, weil sie behindert sind.
»Täter«-»Opfer«-Positionen sind nicht eindeutig auszumachen. Krahes »Helden« sind weder muntere
Lebenskämpfer noch hilflose Hilfsbedürftige. Die »Untätigen«, »auf immer Flachgelegten und Angewiesenen«
begehren auf, so wie der bettlägerige »Spucker«, der sich gegen die aufdringliche »Liebesdienerei« der »Fütterer«
mit seinen »Anschlägen« wehrt.
»Macht« und »Ohnmacht« sind hier anders verteilt. Nicht nur »Gesunde« bevormunden »Kranke«,
»Kranke« unterdrücken und quälen auch »Gesunde«. Der »Blindenblick« schaut so auf ein weiteres Tabuthema:
Behinderte fallen sich selbst und anderen zur Last, werden »aggressiv« und spielen mit »boshafter« Häme ihre Schwäche tyrannisch aus.
In Krahes »Reisen in das beschädigte Leben« begegnet der Leser auch »Mitreisenden« - Angehörigen, Pflegern und
Therapeuten - und wird erneut mit »anstößigen Details« konfrontiert. Eine Mutter will die Organe ihres toten Sohnes auf »keinem
Altar« opfern und würdevoll Abschied nehmen von dem Körper, in dem ihr »Liebstes versunken war«. Permanent überforderte
Angehörige kommen zu Wort, die beschädigtes Leben nicht aushalten, nicht ertragen können, Betroffene, die Schuldgefühle durch
übermäßige Zuwendung ersticken, Behinderung als Makel, als Stigmatisierung ihrer Person deuten und den »Ekel«, das
»Entsetzen« über die Beschädigung ein Leben lang nicht überwinden.
Krahes Texte fordern theologische Antworten heraus, die anders orientiert sind als berufsmäßige Hilfe oder einklagbare Solidarität. Der
»Spucker« in Krahes Geschichte um einen Schwerstbehinderten erlebt unter einem Holzkreuz liegend, an dem ein »ausgebluteter
Jesus« hängt, seine tagtägliche Entmündigung durch professionelle Fürsorger. Aber er erfährt in diesem Kreuz auch einen
Gott, der selbst Opfer der Beschädigung, Behinderung und Entwertung ist, und gerade so die Menschenwürde jedes einzelnen unwiderruflich sichert.
Von hier aus verbietet sich die Ausgrenzung beschädigten Lebens, aber auch die passive Anpassung des Leidenden an seine Beschädigung. Der
»Blindenblick« auf das Kreuz durchbricht das Klischee vom demütigen Dulder und das schöngeredete Arrangieren mit Beschädigungen und
plädiert für eine »Symbiose« zwischen Gesunden und Kranken, die in der Geschichte des »mißlungenen Entwurfs« als
Lebenshaltung und Lebensmöglichkeit beschrieben ist: »Zärtlichkeit finden« zu der »Häßlichkeit«, »weich
werden« an der »Entstellung«.
Elisabeth Hurth in Evangelische Kommentare 97/6
Nicht blind von Beruf – Zum Tod der Schriftstellerin Susanne Krahe
Eine vielversprechende Theologin erblindet. Sie bekommt eine Niere transplantiert und eine Bauchspeicheldrüse dazu. Sie wird unsanft aus ihrer wissenschaftlichen Karriere gerissen und findet sich mit Anfang Dreißig unter mütterlicher Aufsicht in ihrer alten Heimat wieder. Was nun? Zu ihrem und unserem Glück kann sie schreiben, konnte es schon vor ihrer Erblindung. Aber jetzt sieht sie klarer. Und tiefer. Ihr durch keine glatte Oberfläche mehr zu täuschender Blick dringt bis in die Randbezirke des menschlichen Lebens vor. Dort kämpfen Menschen auf der Intensivstation ums Leben oder warten im Pflegebett auf die „Fütterung“. Dort wird eine Blinde wie ein lästiges Paket abgestellt und eine Gehbehinderte zum Klotz am Bein.
Susanne Krahe macht ihr Leben zum Material, begutachtet das hinter und vor ihr Liegende mit kühlem Blick, formt um, lässt weg, erfindet hinzu und wird so zur Schriftstellerin. Das Schönreden und Schönfärben ist ihre Sache nicht. Wer gerne fromme Märchen oder wundersame Heilungsgeschichten liest, ist bei ihr an der falschen Adresse. Wer aber keine Angst vor „Reisen in das beschädigte Leben“ hat, wird mit Texten von höchster literarischer Qualität und Intensität belohnt. Dabei formt das Blindsein dieser Autorin eine ganz eigene, die Wirklichkeit mit Händen ertastende Sprache von frappierender Anschaulichkeit. Da steht ein Fragezeichen mitten im Raum, ihm wird der Kopf abgebissen. Da klebt ein Blick an den Brillengläsern fest. Da hinterlässt das "Verpacken" einer traumatischen Erfahrung „Schnitte, die die seidenen Kordeln beim Festzurren in die Fingerkuppen ritzen.“
Auch die Bibel war für Susanne Krahe eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Aus den biblischen Geschichten machte sie moderne Literatur, indem sie die Geschehnisse auf überraschende Weise aktualisierte und verfremdete. Durch diese „literarische Exegese“ wird ein frischer Blick auf scheinbar Bekanntes möglich. Der Evangelist Markus geht als zweifelnder Sucher auf die Reise, aus Rahel wird eine auf Rache sinnende Frau, während Jesus zum „defekten Messias“ mutiert, der seine Jünger durch stotternde Reden und spastische Zuckungen verunsichert. So hatten sie sich den Erlöser nicht vorgestellt.
Wer Susanne Krahe persönlich begegnete konnte erleben, wie geschickt sie manch täppische Befangenheit von uns „Augenmenschen“ auflöste und mit dem ihr eigenen Humor in ein angeregtes Gespräch verwandelte. Da hat sich eine aus ihrer „Dunkelkammer“ ins Freie geschrieben, da hat eine aus ihrem Leben Funken geschlagen, die in manche Nacht hineinleuchten. Wir können nur dankbar sein für dieses Geschenk.
Susanne Krahe ist am 20. August 2022 gestorben. Sie wurde 62 Jahre alt.
Nachruf von Carola Moosbach
erscheint am 1.11 im Magazin P&S (Magazin für Psychtherapie und Seelsorge)
2 Aufgrund des Kleinunternehmerstatus gem. § 19 UStG erheben wir keine Umsatzsteuer und weisen diese daher auch nicht aus.